Meine Angst wird volljährig!

Dieser Gedanke kam mir letztens ganz plötzlich. Es ist nicht so, als würde ich noch ständig daran denken. An meine Angst. Die Panikattacken. Wie es war, als sie zum ersten Mal auftrat. Aber manchmal schleicht sich die Erinnerung doch noch an. Vieles habe ich mit der Zeit vergessen oder vielleicht verdrängt. Ich habe leider in meinen Tagebüchern meine psychische Erkrankung nie erwähnt. Warum eigentlich nicht? Stattdessen habe ich über belanglose Dinge geschrieben. Aber nicht, wie die Angst alles verändert hat in meinem Leben.
Ich mache kein Geheimnis (mehr) daraus. Ja, ich leide unter Panikattacken. Ja, ich nehme ein Antidepressivum. Ja, ich war lange in Therapie, auch in der Psychiatrie – zweimal. Das alles ist ein Grund dafür, weshalb ich so spät eine Ausbildung gemacht, das Abitur nachgeholt habe und jetzt erst studiere. Heute möchte ich mit euch die Volljährigkeit meiner Angst feiern. Klingt verrückt? Dann passt das ja!
Was heißt das, 18 Jahre Angst? Wie lebt man damit? Gute Frage. Hätte man mich das vor 18 Jahren gefragt, hätte ich gedacht, es ginge nicht. Ich müsste mich nun immer zu Hause verschanzen. Doch die vielen Jahre und Erfahrungen haben mir gezeigt: man kann mit Angst leben. Man kann alles mit ihr schaffen.
Ich weiß ungefähr noch, wann es passierte. Es war 2000. Das Millennium. Erinnert ihr euch noch an Silvester 1999 und der Angst, dass um Mitternacht plötzlich Geräte nicht mehr liefen, weil sie mit der Umstellung der Jahreszahl nicht zurecht kommen könnten? Eine sehr aufregende Zeit. Aber darum soll es nicht gehen. Wenn ich mich korrekt erinnere, muss es ein grauer Tag im Februar gewesen sein, an dem meine Angst zum ersten Mal auftrat. Es war ein Schultag. Anfang 2000, das bedeutet, ich war im zweiten Halbjahr der 8. Klasse auf dem Gymnasium. Meine Noten waren durchschnittlich, ich mochte Deutsch und Englisch am liebsten. Weniger zurecht kam ich mit naturwissenschaftlichen Fächern. Mein Bruder und ich waren auf derselben Schule. Er hasste es, wenn ich in den Pausen zu ihm ging. Immerhin ist er vier Jahre älter als ich und war zu dem Zeitpunkt in der 11.2. Alles war ganz normal.
Nicht ganz. Denn es gab etwas, was ich tief in meinem Inneren begraben hatte. Doch als die Angst in mir hochkroch, kamen die Erinnerungen hoch. Ich horchte auf. Was fühlte ich? Wie fühlte ich mich? Schummrig. Oh Gott. Bekomme ich einen epileptischen Anfall, wie mein Bruder mehr als ein Jahr vorher? Plötzlich musste ich weg. Einfach raus aus der Schule. Raus aus der Situation. Um zuhause anzurufen, musste man damals ins Sekretariat. Denn um die Jahrtausendwende gab es zwar schon Handys, aber wer besaß damals schon eins? Bestimmt keine 14jährige Schülerin. Da meine Mutter allerdings kein Auto hatte, musste ich mit dem Bus nach Hause fahren. Die ganze Zeit über hatte ich Angst. Heutzutage würde ich mich mit meinem Handy ablenken, Musik hören oder lesen. Aber MP3 Player gab es damals nicht, zumindest kannte ich sowas noch nicht. Einen CD Player besaß ich vielleicht, aber ich hörte damals nicht so viel Musik. Bücher hatte ich auch nie dabei.
Die 20minütige Fahrt war der Horror für mich. Dann musste ich noch zehn Minuten zu Fuß gehen…
Ich wusste nicht, was mit mir los war. Dachte, ich würde krank – oder könnte einen Krampfanfall bekommen. Seit dem Tag war nichts mehr so, wie es vorher war. Es folgten viele weitere Tage, an denen ich in der Schule Angst bekam und früher nach Hause ging. Manchmal wollte ich einfach nur kurz raus, um der Situation zu entkommen. Oft blieb ich auch ganz zu Hause. Denn mit der Schule verband ich dieses Gefühl, was ich an jenem Tag plötzlich hatte. Für meine Eltern war das eine schwere Zeit, denn sie wussten nicht, was los war, wie sie mir helfen konnten. Verständnislosigkeit und keine Ahnung, wie sie mit mir umgehen sollten, machte sich breit.
Stell dich nicht so an. Reiß dich zusammen.
Die 8. Klasse schaffte ich, ohne sitzen zu bleiben. Doch besser wurde es auch nicht. Es folgten Arztbesuche, viele Tage zu Hause. Die Zeit verging. Meine Mutter ging mit mir zu einer Psychologin, die das ganze jedoch nur als “Phase” abstempelte. Schließlich rief meine Mutter bei der Ambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum an. Es muss so Ende 2000 oder Anfang 2001 gewesen sein, als meine Eltern mit mir zum ersten Termin gingen. An die einzelnen Termine erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß jedoch noch ganz genau, wo die Ambulanz war, denn mittlerweile wohne ich nicht weit davon entfernt. Lustig, dass mein Freund, den ich ja damals noch gar nicht kannte (obwohl er mit meinem Cousin und Nachbarn befreundet war), ganz in der Nähe von der Psychiatrie wohnt.
Der erste Schritt zur Besserung
Ich sollte in die Tagesklinik. Das bedeutet, man ist montags bis freitags morgens acht Uhr bis zum späten Nachmittag bzw. freitags frühen Nachmittag in der Klinik, geht dort zur Schule, isst zu Mittag, hat Therapie und Gruppenaktivitäten – auch in den Ferien (außer Schule natürlich). Ich sollte Unterlagen von meiner Schule bekommen, allerdings habe ich nie welche erhalten. Es stand eh schon fest, dass ich sitzenbleiben würde. Diese Nachricht war für mich fast ein Weltuntergang. Ich war es gewohnt, seit der 5. Klasse neben meiner besten Freundin zu sitzen.
Die Zeit verbinde ich mit gemischten Gefühlen. Einerseits haben mich die Wochen dort etwas selbstbewusster werden lassen. Andererseits fühlte ich mich dank der Mitpatienten unwohl. Die waren etwa in meinem Alter und wirkten schon “erwachsener”. Ich, das Kräutchen Rührmichnichtan, unscheinbar, unsicher. Die anderen: viel selbstbewusster, wie man sich Teenager eben vorstellt. Ich erinnere mich noch an zwei Situationen.
Wir saßen auf einer Wiese in der Sonne. Irgendwann kam das Thema Jungs auf und damit verbunden auch Sex. Ich war 15, völlig unerfahren, was Jungs betraf und hatte auch nicht das dringende Bedürfnis, das in naher Zukunft zu ändern. Die Mädchen waren völlig entsetzt. Eine war, soweit ich mich erinnere, 14, die andere, meine ich, schon 17. Jedenfalls weiß ich noch, dass die zu mir sagten: “Waas? Du bist noch jungfrau?!”
Die andere Sache hat mit Körperbehaarung und Rasieren zu tun. Auf mein Äußeres legte ich nicht viel wert und schminkte mich auch nicht. Ich kannte es von zu Hause nicht anders. Meine Mutter besitzt zwar auch heute noch ein paar Lippenstifte, die sie benutzt, und auch Parfüm, aber das war es. Ich erinnere mich, dass sie mal blauen Lidschatten hatte, aber nie auftrug.
Ich rasierte mich nicht. Heutzutage ist es ja wieder in Mode, sich als Frau die Haare an Beinen und Achseln wachsen zu lassen. Aber gerade bei Teenagern Anfang des 21. Jahrhunderts wäre das undenkbar gewesen. Es war ein recht angenehmer Tag und ich trug einen Rock. Es störte mich nicht, dass man meine hellen Haare an den Beinen sehen konnte. Ich hatte mir nie darüber Gedanken gemacht. Wir gingen über den Klinikumsparkplatz, als mich eines der Mädchen fragte, ob ich nicht kalt hätte. Normalerweise war ich nie so schlagfertig, aber in dem Moment antwortete ich: “Nein, meine Beinhaare halten mich warm.” Wir müssen vorher wohl über das Thema gesprochen haben.
Anfangs waren meine Eltern dagegen, dass ich Medikamente bekommen sollte. Doch der Arzt sprach mit ihnen und sie stimmten schließlich ein. Ich bekam zum einen ein Medikament, damit ich besser schlafen konnte. Ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren mal danach gegoogelt habe. Gut, dass das Internet 2001 noch nicht mit so vielen Informationen gefüllt war, wie heute. Genau kann ich euch nicht mehr sagen, welches Medikament das war. Das Heftchen, in das die Betreuer alles eingetragen haben, liegt in meinem alten Zimmer bei meinen Eltern. Das Medikament muss noch relativ neu gewesen sein und die Einnahme konnte auch unter Umständen zu keinem guten Ergebnis führen, um es mal so auszudrücken. Das schockierte mich.
Das andere Medikament war Fevarin, ein Antidepressivum, was ich lange genommen habe. Vor ein paar Jahren hat mein Neurologe mir aber Venlafaxin verschrieben, was besser zu sein scheint.
Um es kurz zu machen: Seit 2001 nehme ich ein Antidepressivum. In dem Jahr wechselte ich zur Realschule und wiederholte dort die 9. Klasse. Zunächst lief alles ganz ok, auch wenn der Wechsel fast schon ein Kulturschock war. Die Schüler waren so ganz anders, als ich es vom Gymnasium kannte.
Der zweite Klinikaufenthalt
Meine Therapeutin schaffte es nicht, mir zu helfen – ich mochte sie aber auch nicht. In der 10. Klasse ging es mir wieder schlechter. Dazu kam, dass ich starken Eisenmangel hatte, den man nie erkannte hatte. Es ist auch nie jemand darauf gekommen, den Wert mal zu untersuchen.
Die Realschule verließ ich mit einem Hauptschulabschluss. Den Realschulabschluss sollte ich im Herbst 2003 auf einem Berufskolleg nachholen – das Berufskolleg neben meinem alten Gymnasium. Zwei Jahre zuvor habe ich noch gesagt: wenn ich den Realschulabschluss habe, komme ich wieder zurück.
Doch statt rechts zum Gymnasium zu gehen, ging ich links zum Berufskolleg. Ich wollte es so sehr schaffen. Aber es klappte nicht. Ein paar Wochen später wurde ich auf Station eingewiesen.
Ich musste mir ein Zimmer mit anderen Mädchen teilen. Handys wurden eingeschlossen und durften abends für eine halbe Stunde benutzt werden. Die erste Zeit durfte ich keinen Besuch bekommen. Ich war 17, heulte aber wie ein kleines Kind. Ich wollte nicht da sein, doch ich konnte nichts tun. Meine Eltern wollten mich nicht rausholen, dachten, es wäre das beste für mich.
Fünf Wochen später, genau eine Woche, bevor ich 18 wurde, sah ich meine Chance: ich sollte extern zur Schule gehen, musste also mit dem Zug von Aachen nach Herzogenrath fahren. Doch ich stieg eine Station vorher aus und ging nach Hause. Der Klinikaufenthalt war für mich die Hölle. Ich wurde gemobbt, wollte nicht da sein, fühlte mich unwohl. Es brachte gar nichts. Also holte meine Mutter mich raus.
Zur Schule ging ich nicht. Allerdings fand ich recht schnell eine sehr nette Therapeutin, die mich noch einige Jahre begleitet hat.
Irgendwann wurde alles besser
Durch die Therapie ging es allmählich aufwärts und um mich wieder an einen geregelteren Alltag zu gewöhnen, machte ich ein paar Tage die Woche ein Praktikum in einem Kindergarten. Damals war ich der Meinung, das wäre was für mich.
Ab Mitte 2004 ging ich wieder zur Schule, diesmal versuchte ich es auf einem anderen Berufskolleg. Und es klappte! Doch was ich beruflich machen sollte, das wusste ich nicht. Ich war fast 20 und hatte keine Ahnung. Also machte ich weiter Schule, schrieb aber auch Bewerbungen. Allerdings kam nie eine positive Antwort zurück.
Ich dachte, die schulische Ausbildung (inklusive Fachabi) zur IT Assistentin wäre das richtige für mich. Doch leider war das nicht der Fall. 2009 hatte ich dann die Zusage zu einer Ausbildung zur Fachangestellten für Medien – und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek bei der FH Aachen! Ich freute mich richtig. Das passte zu mir!
Leider wusste meine Chefin von meiner Vergangenheit. Zunächst dachte ich mir nichts dabei, doch kurz vor Ablauf der Probezeit, Anfang November 2009, wurde ich gekündigt. Mit der Begründung, man habe Angst, ich könne einen Rückfall bekommen. Dabei ging es mir gut. Zum ersten Mal nach so langer Zeit hatte ich ein Ziel vor Augen, ein Erfolgserlebnis. Und dann wurde mir das alles wieder genommen.
Es folgten Wochen, in denen ich nichts mit mir anzufangen wusste. Ich suchte nach neuen Ausbildungsstellen, wurde zu Gesprächen eingeladen. Doch alles ohne Erfolg. Dann, Anfang 2010, eine Nachricht von einer Freundin: sie kannte eine Apotheke, die eine Auszubildende zur PKA sucht. Sie selber hätte die Stelle zwar bekommen, hat sich aber für was anderes entschieden. Also bewarb ich mich. Ich durfte Probearbeiten und bekam die Stelle.
Dir Panikattacken waren nicht verschwunden, aber mir ging es besser. Ja, mir ging es sogar gut. Wie ihr wisst, habe ich die Ausbildung geschafft.
Und nun?
Irgendwann habe ich akzeptiert, dass ich unter einer Angststörung leide. Die Angst betrachte ich nun als einen Teil von mir. Durch die Angst bin ich der Mensch geworden, der ich nun bin. Das klingt so philosophisch. Aber ich glaube, dass es wahr ist.
Ich war lange Zeit sauer auf meine Eltern, dass sie auf die Therapeuten in der Klinik gehört haben und mich in die Realschule gesteckt haben. Denn man sieht ja, dass der Wechsel nichts gebracht hat. Auch den Nutzen der Klinikaufenthalte zweifle ich an. Sollte ich mal ein Kind haben, was auch unter Ängsten leidet – würde ich dann genauso wie meine Eltern handeln? Ich möchte nicht, dass mein Kind die gleichen Erfahrungen macht.
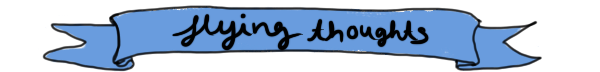



Comments ()